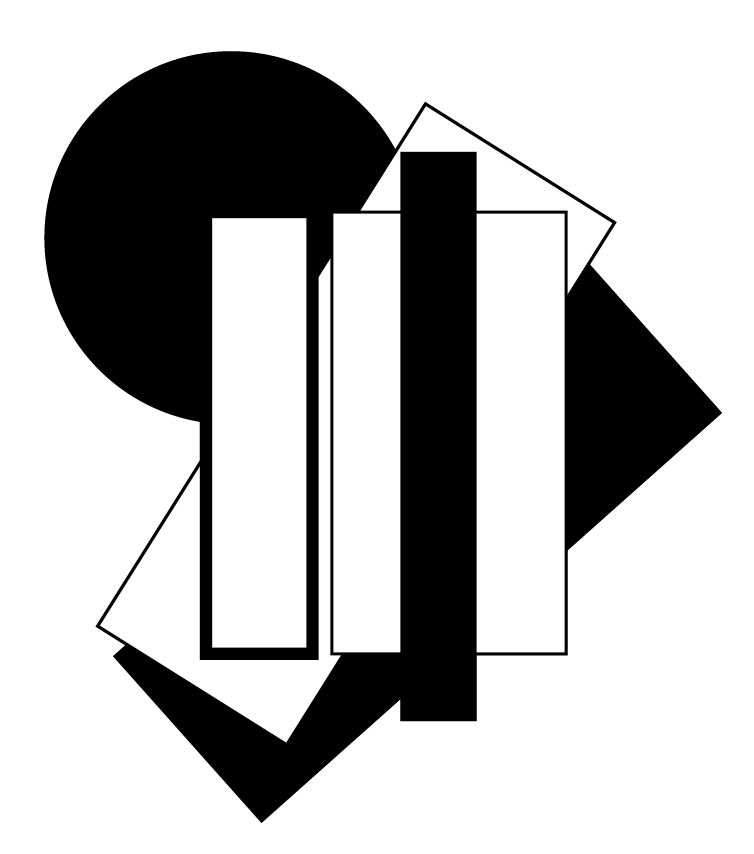Film, 1:47:02
CN: Krieg, traumatisierte Soldaten, tote Menschen
Achtung, Spoiler!
Kinder im Krieg
Von der ersten Sekunde an wirft Dunkirk einen schonungslos in den Terror und das allgegenwärtige, plötzliche Sterben des Kriegs. Ein schwarzhaariger Soldat, mehr ein Kind als ein Mann, wird bei einer kurzen Pause mit seinen Kameraden von Schüssen überrascht. Sie rennen um ihr Leben, alle werden getroffen, nur er kann sich retten. Eine Gruppe französischer Soldaten lässt ihn durch ihre Barrikade in Sicherheit, nachdem er sich als Engländer geoutet hat. Doch er darf sich nicht bei ihnen erholen. Sie sagen nur „Allez, Anglais. Bon voyage.“ („Lauf, Engländer. Gute Reise.„) und schicken ihn fort. Er muss weiter rennen, weiter machen, es gibt keine Pausen im Krieg.
Dem Zuschauer ist nach ein paar Minuten klar, in dieser Geschichte bekommt niemand etwas geschenkt. Das hier ist kein heldenhafter Kriegsfilm, in dem die Kameraden gegen den Feind zusammenstehen und man Gut und Böse klar unterscheiden kann. In Dunkirk ist von all dem noch weniger übrig als in vorigen (Anti-)Kriegsfilmen oder -serien wie beispielsweise „The Pacific“ von 2010. Hier gibt es nicht mal mehr Kameraden oder nur ein nettes Wort und von den Massen an Soldaten lernt der Zuschauer kaum einen mit Namen kennen. Man folgt ihnen eine Zeit lang, doch man weiß nichts über sie. Sie bleiben anonym, austauschbar, eine Masse.
Es ist Anfang des Zweiten Weltkriegs. Englische und französische Soldaten sind in der französischen Hafenstadt Dunkerque (auf englisch Dunkirk, auf deutsch Dünkirchen), die an Belgien grenzt, von der deutschen Wehrmacht eingekesselt. Der Film zeigt eine echte, historische Rettungsaktion, die sich unter dem Namen „Operation Dynamo“ 1940 ungefähr so zugetragen hat. Da sehr viele zivile Fischkutter und andere kleine, private Boote eingesetzt wurden, sprach man in England von dieser Aktion lange Zeit als miracle of the little ships (Wunder der kleinen Schiffe). Ziel der Rettungsaktion war es, die britischen Soldaten vor Tod oder Gefangenschaft zu retten, damit man sie später wieder einsetzen konnte. Es ging hier nicht um Menschlichkeit. Der Verlust fast der gesamten britischen Armee hätte vermutlich das Ende des Krieges (und einen Sieg Deutschlands) bedeutet. Für die Soldaten, die Dunkirk überleben, soll danach der nächste Einsatz folgen. Sie kämpfen tagelang um ihr Überleben, sie entrinnen etliche Male nur knapp dem Tod, sie sind am Ende ihrer körperlichen und psychischen Kräfte, aber sie erwartet kein Urlaub, keine Erholung, kein Abstand zu dem erlebten Grauen. Sie müssen danach wieder ran, der Krieg ist noch nicht vorbei, ihr Job nicht getan.
Die Soldaten warten auf Rettung oder den Tod, sie sind erschöpft und in die Enge getrieben. Es gibt nichts zu essen oder zu trinken. Die Häuser sind verlassen. Niemand ist auf den Strassen. Es herrscht eine tödliche Stille. Der einzige Weg hinaus, zurück nach England ist über das erbarmungslos graue, eiskalte, wütende Meer, über einen Strand, der so flach ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dem Feind aus der Luft zu entkommen. Sie haben keine Chance.
Der Soldat läuft weiter. In langen Schlangen stehen die anderen am Strand, warten auf ein Boot. Ungeschützt, zum Abschuss freigegeben. Doch es ist das Einzige, was sie tun können. Er stellt sich an, ein Mann vor ihm dreht sich um. „Die ist für Grenadiere, Mann.“ Der Soldat senkt den Kopf, er geht weiter. In seinem abgezehrten, müden Kindergesicht sieht man, dass er Bescheid weiß. Sein Blick ist leer. Niemand will ihn, niemand interessiert sich für sein Überleben. Er ist nur eine kleine Ratte, wie tausend andere, nichts wert im Krieg, in dem für den Einzelnen kein Platz ist.

Plötzlich ertönt ein Sirren, er sieht zum Himmel. Ein Angriff aus der Luft. Alle Männer stieben auseinander, werfen sich wie ein choreografierter Flashmob auf den Boden. Das Sirren wird intensiver, dröhnt in den Ohren. Hinter dem Soldaten detonieren Granaten. Die Einschläge kommen näher, ein Mann wird in die Luft gerissen. Sand landet auf den Haaren des Soldaten, er hält die Hände Schutz suchend über seinen Kopf, duckt sich wehrlos auf dem Boden.
Dunkirk schafft es wie kaum ein Film zuvor, die Gewalt und Bedrohung des Krieges eindrücklich zu verdeutlichen, ohne abgerissene Gliedmaßen oder verstümmelte Leichen zu zeigen. Im gesamten Film fließt kaum Blut und doch ist er zermürbend, brutal und gnadenlos. Der Kampf ums Überleben dieser jungen Soldaten, die grade noch Kinder waren, ist so ausweglos und auslaugend, dass es keine grafische Darstellung von zerstörten Körpern o.ä. braucht, die man aus diversen anderen Kriegsfilmen der letzten Jahre und Jahrzehnte kennt1. Dunkirk fokussiert sich viel mehr auf die psychischen Auswirkungen, auf die Erschöpfung, Mutlosigkeit, die übermenschliche Anstrengung des Überlebenskampfes, die grundlegendsten Instinkte und weniger auf die physische Zerstörung der menschlichen Körper, wie es andere Filme zum Thema haben.

Auf dem Meer
Die zweite Geschichte des Films dreht sich um eine Gruppe von Zivilisten. Ein älterer Mann, Mr. Dawson, sein Sohn Peter und ein Freund der Familie im Teenageralter, George, fahren mit einem privaten Fischerboot von England aufs Meer Richtung Dunkerque, um als Teil einer zivilen Hilfsaktion einzelne Soldaten retten zu können (was im Eingangstext als miracle of the little ships bezeichnet wurde). Sie sind gute Menschen, die den eingepferchten Soldaten helfen wollen und dafür ihr eigenes Leben in Gefahr bringen. Ihre Wollkleidung in warmen Farben (dunkelrot, ockergelb, grau-meliert, braun) verspricht die herbeigesehnte Sicherheit der Heimat, ihr Holzboot strahlt Wärme und Geborgenheit aus und steht im scharfen Kontrast zum Eisgrau und Blaustich der Kriegsszenerie. Sie haben Tee und Decken und können ein paar wenigen, erschöpften Soldaten eine Perspektive bieten.
Im weiten, kalten Meer stoßen sie bald auf einen Soldaten, der auf etwas sitzt, was wie ein Teil eines Schiffswracks aussieht. Die Szene hat etwas Unheimliches, der Soldat sitzt wie Batman düster inmitten der tobenden See, unter einem schweren, bedrohlich-grauen Himmel. Man weiß nicht, was man von ihm halten soll oder was hier vorgefallen ist. Es muss etwas Schlimmes gewesen sein.

Er wird auf dem Boot aufgenommen und schlägt jede helfende Hand von sich, nimmt nur die allernötigste Hilfe an. Am ganzen Körper zitternd sitzt er da in seiner nassen Uniform, Wasser läuft ihm aus den schwarzen Haaren und starrt ins Leere, spricht kein Wort. Bei jedem entfernten Bombendonner fährt er zusammen. Er schlägt George die angebotene Tasse Tee aus der Hand, möchte nicht unter Deck gehen. Mr. Dawson beobachtet ihn besorgt, die Jungs wirken nervös in seiner Gegenwart.
„Lass ihn zufrieden, George. Er fühlt sich hier an Deck sicherer. Würdest du auch, wärst du bombardiert worden.“
„U-Boot. Es war ein U-Boot.“
Das ist fast der einzige Satz, den dieser namenlose Soldat im gesamten Film von sich gibt und alles, was der Zuschauer zu seiner Situation erfährt. Er agiert nur noch instinktiv, der typische shell-shocked soldier2.
Als er erfährt, dass das Boot nicht nach England, sondern zurück Richtung Dunkerque fährt, bettelt er schon fast darum, umzukehren. Er möchte auf keinen Fall zurück in den Krieg. Er ist wie ein Tier, eingesperrt und bedroht, seine Augen wild. Die meiste Zeit hält er den Kopf gesenkt, vermeidet jeden Blickkontakt. Er starrt gradeaus, als würde er nur versuchen, diesen Moment zu ertragen. Sein ganzer Körper zittert. Er hält sich an Wänden und Möbeln auf dem schwankenden Boot fest, hat buchstäblich den Halt verloren.
„Ist er ein Feigling, Mr. Dawson?“
„Er hat einen Granatschock, George. Er ist nicht er selbst. Er wird es vielleicht nie wieder sein.“
Wie schon im Text zu „Die Männer“ erwähnt, geht es beim Thema Krieg auch immer um Männlichkeit/Krise der Männlichkeit. Der Soldat soll stets stark und kraftvoll sein, keine Niederlage akzeptieren. Mit diesem Narrativ aufgewachsen erscheint es nur logisch, dass George den Soldaten, der sich im Gegenteil zu dem verhält, was er über einen Soldaten gelernt hat, erstmal für feige und schwach hält. Kriegspropaganda umfasst selbstverständlich nur den heldenhaften Teil des Soldatentums, über traumatische Folgen wird geschwiegen oder sie werden auf das Versagen des Individuums geschoben.
Mr. Dawson begegnet dem traumatisierten Soldaten verständnisvoll und freundlich. Im Verlauf der Geschichte erfährt man seine persönliche Motivation zu dieser Rettungsakion: sein älterer Sohn ist als Teil der Air Force ganz zu Anfang des Krieges gefallen. Vielleicht möchte Mr. Dawson es wieder „gut“ machen, vielleicht seinen Schmerz betäuben oder wenigstens andere retten, die sein Sohn hätten sein können. Vielleicht sucht er seinen Sohn in ihren vor Angst aufgerissenen Augen, in ihren zitternden Körpern, ihrem leeren Blick. Vielleicht fühlt er sich besser, wenn es ihnen besser geht. Peter und George dagegen trauen dem Soldaten nicht. Als er schließlich doch unter Deck geht, um sich etwas auszuruhen, ergreift Peter die Chance und schließt ihn ein. Ein guter Instinkt, aber eine schlechte Entscheidung, wie sich herausstellt, denn der labile Soldat überreagiert in seiner Angst, befreit sich selbst und in Folge eines Handgemenges stößt er George eine Treppe herunter. George verletzt sich schwer am Kopf und stirbt ein paar Stunden später. Ein Kriegsopfer, ein totes Kind. Ein instabiler, kaputt gemachter Soldat, der jetzt den Tod eines Jungen zu verantworten hat, der ihm nur helfen wollte: das hässliche Antlitz des Krieges.
Meditative Schönheit im Krieg
Der dritte und letzte Erzählstrang folgt einer Gruppe von Piloten der englischen Luftwaffe, die über den Strand von Dunkerque kreisen und versuchen, die Soldaten am Boden vor Luftangriffen zu schützen, indem sie die feindlichen, deutschen Flieger abschießen. Von diesen Piloten ist besonders einer im Fokus, Farrier. Man sieht fast nie sein Gesicht, da es die meiste Zeit hinter einer Maske verborgen ist. Nur seine Augen bewegen sich, suchen den Himmel ab, seine Stimme kommentiert seine Handlungen. Dieser Pilot ist am ehesten eine „Heldenfigur“, da er letztlich alleine den deutschen Flieger bezwingt und von den Soldaten am Boden und im Wasser angefeuert und bejubelt wird. Auch ist er der einzige, in dessen Szenen ab und an die Sonne scheint und der Himmel blau ist, was ein positives Licht auf diese Figur wirft.
Die Szenen im Flieger sind von meditativer Schönheit, die dem Zuschauer Ruhe inmitten des Grauens verschafft. Hier kann man aus der Ferne auf alles blicken und die unendlichen Weiten von Himmel und Meer genießen. Farrier und die anderen Piloten haben das Privileg, den Krieg aus einer Distanz erleben zu können, für sie ist es einfacher, einen „Job“ zu machen. Sie stehen dem Feind nicht Millimeter entfernt gegenüber, sie müssen niemanden mit den eigenen Händen töten. Wenn sie ein Flugzeug abschießen, wissen sie zwar, dass ein Mensch darin sitzt, sie sehen ihn aber nie, haben keine persönliche Verbindung zu ihm. Der Feind bleibt eine abstrakte, unbekannte Figur, wie in einem Computerspiel.
Die Schönheit der Natur überdauert den Krieg. Der großartige Score von Hans Zimmer unterstützt diese Empfindungen und lässt einen für Sekunden in eine fast übersinnliche Traumwelt eintauchen. Hier gibt es kein Oben und Unten mehr, es gibt keine materiellen Dinge, nur Atmosphäre. Eine ästhetische Parallele kann zu „Apocalypse Now“ gezogen werden. Auch hier werden Kriegsgrauen mit wunderschönen Naturaufnahmen unterlegt. Man bewundert, genießt die Umgebung, die Lichter, den Nebel, die prächtigen Farbkontraste. Es macht die Szene umso grotesker, weil es eine absurde Entspannung mit sich bringt, sich inmitten des Kriegshorrors von diesen Bildern einlullen, vernebeln zu lassen.

Christopher Nolan und die Zeit
Dunkirk arbeitet, wie viele vorige Filme von Christopher Nolan, mit verschiedenen Zeitebenen. Die Geschehnisse werden nicht linear, sondern versetzt erzählt und ergeben erst Sinn, wenn man das Gesamtbild kennt. Es ist ratsam, sich den Film mehrere Male anzusehen, damit man diese Zeitverschiebungen versteht oder sich zumindest einen Reim darauf machen kann. Zu Anfang jedes Erzählstranges gibt es immer eine Zeitangabe.
- Die Mole: 1 Woche
- Die See: 1 Tag
- Die Luft: 1 Stunde
Im Verlauf des Filmes wird es zunehmend schwieriger, diese Zeiten im Kopf zu behalten. Man vergisst irgendwann, wie lange nochmal welche Geschichte dauert. Harren die Soldaten am Strand jetzt eine Woche oder einen Tag in dieser erdrückenden Lage aus? Es wird egal, es ist alles wie ein nie endender Tag und vielleicht ist das auch der Zweck dieser Zeitangaben; sodass man, wie die Protagonisten, das Zeitgefühl einfach verliert und alles zu einem Brei wird, wie nach einer durchgemachten Nacht.
Eine Geschichte so versetzt zu erzählen, bietet die Möglichkeit, die selbe Szene aus verschiedenen Perspektiven zeigen zu können. Es gibt eben mehr als „eine Wahrheit“. Dazu wird durch diese Methode stets eine Spannung aufrecht erhalten, weil man das Puzzle der einzelnen Stränge und Szenen zusammensetzen und möchte und einen Sinn im Ganzen zu erkennen versucht.
In Dunkirk befindet sich der Zuschauer ausschließlich im Hier und Jetzt. Es gibt zu den Charakteren keine Hintergrundgeschichten in Form von Rückblicken oder Dialoge, in denen sie etwas über sich erzählen. Man kann über ihr Leben nur mutmaßen, sich an manchen Details etwas vorstellen. Der traumatisierte Soldat auf dem Boot beispielsweise trägt einen Ehering, also ist er vermutlich verheiratet. Ansonsten sind sie sozusagen leer, unbeschrieben. Wir wissen nichts über sie, ihre Motivation oder ihr Leben vor dem Krieg. Wir sind nur hier mit ihnen, begleiten sie für einige Zeit und verlassen sie danach wieder.
Obwohl es ausreichend Filme zum Thema Krieg gibt, hat Dunkirk es geschafft, nochmal einen neuen Blick darauf zu werfen. Der Fokus auf das psychische Erleben des Kriegsgrauens und des Überlebenskampfes zeigt eine Ebene auf, die in anderen Filmen und Serien nicht in dieser Eindrücklichkeit behandelt wurde. Auch das Gefühl der Austauschbarkeit, des Untergehens des Individuums unter der Masse, Krieg als System sind Aspekte, die hier angesprochen werden. Jegliche Heldenverehrung oder Kriegsverklärung findet nicht annähernd statt, es ist ein sehr realistischer, unbarmherziger Blick. Wenn ein Film Krieg an Personen heranbringen kann, die mit ihm im echten Leben niemals in Berührung gekommen sind, dann ist es wohl Dunkirk.
Quellenangaben
- zum Beispiel die Szene aus der HBO-Serie „Band of Brothers“ von 2001, in der dem Soldaten Joe Toye sein Bein weggebombt wird und man sehr detailreiche Einblicke in diese Situation bekommt ↩︎
- das ist ein bekannter Trope, der in diversen Kriegsfilmen auftaucht und wie folgt beschrieben werden kann: „In fiction, this character went through hell and he has done things that no amount of (fictional) therapy will heal, and it’s left him so irrevocably scarred that he has trouble feeling, emoting, or caring about the people around him and even oneself.(…) Most Shell-Shocked Veterans will, at some point or another, be seen exhibiting the classic Thousand-Yard Stare; with a blank, emotionless expression and unfocused, empty eyes.“ (gefunden auf tvtropes.org/shell-shocked veteran). ↩︎