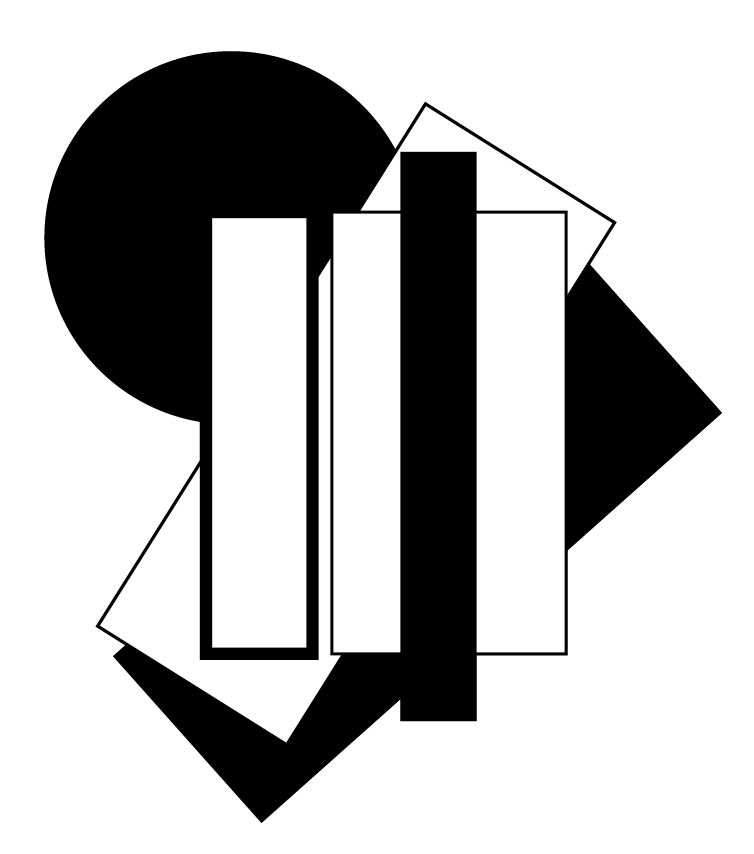Die britisch-amerikanische Fantasy-Fernsehserie „Outlander“1 erzählt die Geschichte von Claire Randall (geborene Beauchamp), einer verheirateten Krankenschwester, die in Schottland kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges beim Betreten eines mystischen Steinkreises 200 Jahre in die Vergangenheit reist. Nach dem Erwachen im Jahr 1743 gerät sie unmittelbar in einen Kampf zwischen englischen Soldaten und schottischen Rebellen. In dieser Situation lernt sie Jamie Fraser kennen, einen jungen schottischen Kämpfer, auf welchen zu dem Zeitpunkt ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er wird verletzt und sie versorgt ihn. Anschließend wird sie von der Gruppe mit zur Burg Leoch genommen, in der der Großteil der ersten Staffel spielt. Zwischen Claire und dem etwas jüngeren Jamie entsteht eine Liebesgeschichte. Aufgrund ihres medizinischen und historischen Wissens erhält Claire auf der Burg schnell den Status einer „Heilerin“/Medizinerin. Da sie aus der Zukunft stammt und Dinge weiß, die noch passieren werden und mitunter in das Geschehen eingreift, wird sie immer wieder verdächtigt, eine „Hexe“ oder Spionin zu sein und gerät häufig in gefährliche Situationen.
Die Serie startete im August 2014 bei dem amerikanischen Pay-TV-Sender Starz und umfasst bisher sieben Staffeln, wobei die 7. Staffel in zwei Teile á 8 Episoden unterteilt ist. Sie basiert auf der sogenannten „Highland-Saga“ der amerikanischen Autorin Diana Gabaldon, dessen erster Teil „Outlander“ (deutsch „Feuer und Stein“) im Jahr 1991 erschien. Der dritte Teil „Voyager“ (deutsch „Ferne Ufer“), welcher 1997 erschien, erreichte auf Anhieb den Status eines New-York-Time-Bestsellers. 2021 wurden die Bücher weltweit bereits 50 Millionen Mal verkauft. „Outlander“ ist die erfolgreichste Serie von Starz und hat pro Episode ca. 9 bis 12 Millionen Zuschauer2. Die Hauptdarstellerin der Serie, Caitriona Balfe, die die Figur der Claire Randall verkörpert, wurde mehrfach für den Golden Globe nominiert.
Der Florence-Nightingale-Effekt
Der Florence-Nightingale-Effekt ist ein wiederkehrendes Erzählmuster, welches in fiktionalen Geschichten auftaucht. Es beschreibt die Konstellation zweier Figuren zu einander: eine Frau, in der Rolle einer Pflegerin und ein Mann, in der Rolle eines Patienten, der von ihr gepflegt und versorgt wird. Aus dieser Situation entsteht eine romantische Beziehung. Dieses Erzählmuster lässt sich bis in die griechische Mythologie zurückverfolgen und ist häufig in Kampf- und Kriegskontexten anzutreffen. Benannt ist das Erzählmuster nach der englischen Krankenschwester Florence Nightingale (1820–1910), die als Pionierin im Gesundheitsbereich gilt. Allerdings spielen hier lediglich der Bezug zur Pflege und ihr prominenter Name eine Rolle. Es gibt keinen Nachweis darüber oder eine Andeutung, ob, bzw. dass Florence Nightingale eine Affäre mit einem Patienten hatte. Erstmals verwendet wurde der Begriff „Florence-Nightingale-Effekt“ in dem Spielfilm „Zurück in die Zukunft“ (1985), als die Figur Dr. Emmett Browne erklärt, wie die Eltern der Figur Marty McFly zusammengefunden haben.
Dr. Emmet Browne: „What did your mother ever see in that kid?“
Marty McFly: „I don´t know, Doc. I guess she felt sorry for him ´cause her dad hit him with the car. (pausiert) Hit me with the car.“
Dr. Emmet Browne: „That´s the Florence Nightingale Effect. It happens in hospitals when nurses fall in love with their patients. (klopft Marty auf die Schulter) Go to it, Kid.“
Zwar tauchte 1985 erstmals der Begriff „Florence-Nightingale-Effekt“ auf, Geschichten, in denen Frauen verletzte Männer heilen und beide sich ineinander verlieben, lassen sich allerdings bis in die griechische Mythologie zurück verfolgen. In Vergils „Aeneis“ (ca. 29–19 v. Chr.) wird Aeneas, der Sohn der Aphrodite, von Dido, der Königin von Karthago geheilt und beide verlieben sich unsterblich ineinander3. Königin Isolde heilt den verletzten Tristan in der Legende von Tristan und Isolde aus dem 13. Jahrhundert und die beiden werden ein (tragisches) Liebespaar. Auch in der Literatur des Barock gibt es viele Abenteuer- und Ritterromane, in denen aus Pflege Liebe entsteht, so zum Beispiel die Amadisromane, mit der Hauptfigur Amadis de Gaula, einem spanischen Ritter, der sich in die englische Prinzessin Oriana verliebt. Nach einen Zweikampf wird er schwer verwundet und Oriana pflegt ihn4.
Sehr häufig lässt sich der Florence-Nightingale-Effekt im Kriegskontext finden, beispielsweise in dem Film „In einem anderen Land“ (1957), der auf dem gleichnamigen Roman von Ernest Hemingway aus dem Jahr 1929 basiert. In dieser Geschichte, die während des Ersten Weltkrieges spielt, verlieben sich der amerikanische Soldat Frederic Henry und die englische Krankenschwester Catherine Barkley ineinander, nachdem sie ihn in einem Lazarett pflegt. In dem Hollywood-Drama „Der englische Patient“ (1996) entsteht aus Fürsorge eine tiefe Liebe zwischen den Figuren Hana, eine Krankenschwester, und ihrem Patienten Graf László Almásy. In jeder Geschichte, in der der Florence-Nightingale-Effekt auftaucht, entsteht eine romantische Beziehung zwischen den beiden Figuren, in manchen Fällen einseitig5, in den meisten beidseitig. Es sind immer heterosexuelle, monogame Beziehungen. Beide Figuren folgen traditionellen Geschlechterkodierungen, so ist die Frau in diesen Szenen immer fürsorglich und der Mann ist immer verletzt, weil er in irgendeinen Kampf geraten ist. Die Schwäche der männlichen Figur hat in diesen Szenen immer mit vorausgegangener Stärke zu tun, die Verletzung ist das Ergebnis heldenhafter Taten. Es gibt keine Szene, in der die männliche Figur ohne besonderen Grund krank wird oder durch Zufall verletzt wurde. Die Rolle der weiblichen Figur verbindet mütterliche Elemente mit denen einer Geliebten. Sie versorgt den verletzten Mann (verbindet ihn, reinigt die Wunde etc.), sie übernimmt aber selten Aufgaben, für die es eine richtige medizinische Ausbildung bräuchte, wie bspw. eine Operation oder das Nähen von Wunden. „Outlander“ unterscheidet sich allerdings an dieser Stelle von anderen Geschichten, da Claire über etwas mehr medizinisches Wissen verfügt. So renkt sie Jamies Schulter wieder ein, richtet seine gebrochenen Finger und operiert als Lazarettschwester auch schwer verwundete Soldaten.
Der zweite, wichtige Aspekt beim Analysieren des Florence-Nightingale-Effekt ist die Fürsorge der weiblichen Figur für die männliche. Sie leistet ihm emotionalen Beistand, indem sie mit ihm spricht, an seiner Seite wacht, ihm Wünsche erfüllt6, ihm Nahrung bringt, ihn pflegt und tröstet. Diese intimen Momente bilden die Grundlage für Zuneigung bis hin zu Liebe. Während die Sorge-Arbeit der weiblichen Figuren oft mit ihrem Beruf erklärt wird (und auch andersherum sie diesen Beruf aus einer vermeintlich „natürlichen“ Fürsorglichkeit gewählt haben), gibt es bspw. in der Mystery-Serie „Lost“ (2004–2010), in der es um Überlebende eines Flugzeugabsturzes auf einer geheimnisvollen Insel geht, keine andere Erklärung als das Geschlecht der Figur Kate. Sie hat weder eine medizinische Ausbildung noch private Erfahrungen als Mutter oder ältere Schwester. Tatsächlich hat sie ihren gewalttätigen Vater ermordet und war gerade auf dem Weg in ein Bundesgefängnis, als das Flugzeug abstürzte. Auf der Insel behauptet sie sich durch körperliche Stärke, Wissen, Mut und Kampfgeist. Sie ist „eine von den Jungs“ und auch stets mit der Gruppe von Männern unterwegs, die die Insel erkunden und Abenteuer bestehen. Sie ist das weibliche Pendant zu der Figur Sawyer, der ebenfalls ein Krimineller ist. Beide Figuren haben eine ähnliche Ausgangslagen und verhalten sich ähnlich, der einzige echte Unterschied zwischen ihnen ihr Geschlecht. Warum also ausgerechnet sie sich um ihn kümmert, kann nur mit stereotypen Geschlechtervorstellungen erklärt werden: er als Mann macht sich auf eine gefährliche Reise und wird verletzt, sie als Frau bleibt am Wohnort und versorgt ihn. Orientierte sich „Lost“ nicht an solchen Klischees, hätte man die Rollen der Figuren auch einfach andersherum verteilen können.
In der gesamten Serie „Outlander“, die bislang 7 Staffeln umfasst, ist der Anteil der Szenen, in denen die Hauptfigur Claire Männer versorgt, deutlich höher als der Anteil der Szenen, in denen sie Frauen versorgt. Auch sind die Männer-Szenen im Schnitt länger und zeigen brutalere Gewalt (Kriegsverletzungen, Auspeitschungen, Vergewaltigung, Verstümmelung etc.), während die Frauen-Szenen deutlich kürzer sind und sich vor allem um Themen von Schwangerschaft und Geburten drehen. Das kann damit erklärt werden, dass Männer durch Kriege und Kämpfe größerer Gefahr ausgesetzt sind. Das Thema sexuelle Gewalt wird in Bezug auf Männer gezeigt. Damit wird ein Thema angesprochen, das medial unterrepräsentiert ist. Auch Claire selbst ist immer wieder sexueller Gewalt und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Sie ist jedoch nie so schwer verletzt, dass sie von einer anderen Person versorgt werden müsste. Eine genaue Untersuchung jeder Szene, in der Claire entweder einen Mann oder eine Frau behandelt und versorgt, gibt es allerdings bisher nicht.
Ein Gegenbeispiel zum Florence-Nightingale-Effekt ist der Film „Die Männer“ (1950), in dem es um querschnittsgelähmte Veteranen in einem amerikanischen Militärkrankenhaus während des Zweiten Weltkrieges geht. An einer Stelle sprechen sie über eine Hochzeit zwischen einem der Veteranen und einer Krankenschwester. Sie betrachten das Thema vor allem sachlich und materialistisch, es geht weniger um Romantik.
Leo: A very nice wedding. Well, I tell you, with her being a nurse and all, I think they got a pretty good chance. It ain´t as if she didn´t know the score.
Norm: She´s doing alright. Instead of taking care of a whole ward for 280 bucks a month, she´s got one patient for 360. The government gives them a transportation allowance, so she´s got a car. The government pays for half a house, so she´s got a home. (lächelt) It´s not bad.
Angel: She´s a nice girl, Norm. She didn´t marry him for his compensation.
Wie man an dieser Szene sieht, ist es durchaus möglich, aus der Konstellation „Frau pflegt verletzten Mann und beide verlieben sich ineinander“ andere Geschichten zu erzählen, als jene, die der Florence-Nightingale-Effekt vorgibt.
Fürsorge, Geschlecht und Macht: Feministische Perspektiven auf Care-Arbeit
Pflegeberufe waren lange Zeit Frauenberufe. Im Gegensatz zu Männern durften Frauen, mit sehr wenigen Ausnahmen, erst ab Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts studieren. Ihr Wissen eigneten sie sich durch Erfahrung im häuslichen Kontext an, außerdem gab es viel allgemeines „Volkswissen“, welches sich aus Alltagserfahrungen, mündlicher Überlieferung und praktischen Tätigkeiten zusammensetzte. Erste Hospitäler wurden im frühen Mittelalter in der Nähe von Klöstern errichtet7. Bis dahin wurden kranke oder verletzte Menschen im häuslichen Umfeld versorgt. Durch ihr Keuschheitsgelübde mussten Nonnen keine Familien versorgen, daher konnten sie sich voll und ganz der Pflege widmen. Im Christentum ist die Vorstellung von Weiblichkeit immer verknüpft mit Selbstlosigkeit, Tugend und Dienen. Dementsprechend kümmerten sich vorrangig Frauen um Kranke und Verletzte. Zu dieser Zeit gab es keinen Unterschied zwischen Pflege und Fürsorge. Erst mit der Professionalisierung der Pflege wurden die Bereiche getrennt, da der medizinische Teil komplexer wurde und es einer richtigen Ausbildung bedurfte. Fürsorge wurde in die (zunächst) unbezahlte „Soziale Arbeit“ ausgelagert, die sich außerdem weiteren gesellschaftlichen Problemen annahm, wie dem Versorgen von Armen mit Nahrung und Kleidung, Kinderpflege und -erziehung usw. Dieser Bereich war eine Frauendomäne, da hier vermeintlich „weibliche“ Eigenschaften wie Zuhören, Empathie und Helfen gefordert sind. In England wurden bürgerliche Frauen, die ehrenamtlich Kranke oder Verletzte besuchten „friendly visitors“ genannt. 1860 gründete Florence Nightingale die „Nightingale School of Nursing“ in London und ermöglichte Frauen eine professionelle Ausbildung und Pflege als bezahlten Beruf. Ein Zitat aus ihrem Buch „Notes on Nursing“ lautet: „A nurse should be devoted, self-sacrificing, gentle and pure, as becomes a woman’s nature.“ In Deutschland wurde von Alice Salomon, einer promovierten Philosophin, 1908 die „Soziale Frauenschule“ gegründet, welche die sogenannte „geistige Mütterlichkeit“ propagierte. Sie setzte sich dafür ein, dass Frauen für Sorgearbeit entlohnt wurden und ermöglichte ihnen dadurch finanzielle Unabhängigkeit. Die Professionalisierung der Pflege bedeutet zwar einerseits eine bessere Ausbildung, andererseits erhöhte sich dadurch der Männeranteil und Frauen wurden in die „Fürsorge/Soziale Arbeit“ gedrängt. In feministischen Texten zur Sorgearbeit wird kritisiert, dass Fürsorge weiterhin als „typisch weibliche“ Eigenschaft gilt, obwohl schon häufig widerlegt wurde, dass Charaktereigenschaften etwas mit dem Geschlecht zu tun haben8. In patriarchalen Gesellschaften stehen Frauen an zweiter Stelle und sind oft abhängig von Männern, die gewisse Privilegien haben. Dazu gehört der Zugang zu Bildung, die Möglichkeit, einer Lohnarbeit nachzugehen, persönliche Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit uvm. Frauen werden häufig Eigenschaften wie Empathie, Geduld, Hilfsbereitschaft, Fürsorglichkeit und Häuslichkeit zugesprochen. „Frauenberufe“ wie die Soziale Arbeit sind im Schnitt schlechter bezahlt und gesellschaftlich weniger anerkannt, dabei sind sie genauso systemrelevant wie männerdominierte Berufe. „If women stopped performing unpaid care work, the economy would collapse tomorrow.“, sagte die feministische Theoretikerin Prof. Dr.´in Nancy Fraser9. Frauen, die wegen der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen eine Zeit lang nicht berufstätig sind oder in Teilzeit arbeiten, haben ein erhöhtes Risiko für Altersarmut, trotzdem landen diese Aufgaben überdurchschnittlich oft bei ihnen. Laut einer Studie der AOK aus dem Jahr 2023 sind 67% der Menschen, die Zuhause ihre Angehörigen pflegen, Frauen10. 1975, also vor fünfzig Jahren, kam in feministischen Kreisen erstmals die Forderung der bezahlten Sorge-Arbeit auf, die bis heute besteht, um Frauen vor Altersarmut zu schützen und aus Abhängigkeitsverhältnissen herauszuholen. Wie in der Studie der AOK belegt, hat sich seitdem kaum etwas geändert. Die Serie Outlander spiegelt patriarchale Strukturen wider, da Claires Rolle als pflegende Frau unhinterfragt bleibt und traditionelle Geschlechterklischees fortschreibt. Obwohl sie kinderlos ist und eine wissbegierige, selbstständige Frau, hadert sie nie mit ihren Aufgaben. Selbstverständlich übernimmt sie die Pflege von Kranken und Verletzten.
The brainy brunette: Claire Randall (geb. Beauchamp)
Claire Beauchamp wurde 1918 geboren und wuchs nach dem Unfalltod ihrer Eltern bei ihrem Onkel, einem Archäologen, auf. Als Kind bereiste sie die Welt und lebte unter anderem in Ägypten und Persien (seit 1935 Iran). 1937, im Alter von 19 Jahren, heiratete sie den Historiker Frank Randall. Die beiden führten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein nomadenhaftes Leben, da Frank aus beruflichen Gründen häufig unterwegs war. Während des Krieges leistete er einen Offiziersdienst, während Claire als Krankenschwester arbeitete, daher hatten sie über Jahre hinweg kaum Kontakt. Claire erarbeitete sich eine Leitungsposition und wurde in einem Feldlazarett in Frankreich stationiert. Die Erfahrungen mit den schwer bis zum Teil tödlich verwundeten Soldaten und ihren grausamen Verletzungen und Verstümmelungen, sowie die schrecklichen Umstände in diesem Lazarett und der Horror des Krieges am eigenen Leib werden sie ihr Leben lang begleiten.

Claire ist nicht nur charakterlich, sondern auch optisch eine untypische Frau, da sie sehr groß ist und eine schlanke, knabenhafte Figur hat. Sie ist fast genauso groß wie die männlichen Figuren, allein der 1,93m große Jamie überragt sie. Sie trägt häufig flache Schuhe und Hosen und ist stets elegant und schlicht gekleidet. Sie hat Geschmack und tritt sachlich und „professionell“ auf. Sie ist hübsch, aber ihr Aussehen steht nicht im Vordergrund. Sie wird an kaum einer Stelle sexualisiert inszeniert. Sie hat dunkles, widerspenstiges Haar und blaue Augen. In einer Studie aus dem Jahr 1989 legten die Autorinnen Susan Weir und Margret Fine-Davis den männlichen Probanden drei Fotos der selben Frau vor, einmal mit blonden, einmal mit braunen und einmal mit roten Haaren. Das Ergebnis war eindeutig: sie bewerteten die blonde Frau tendenziell als weniger intelligent als die braunhaarige11. Dieses Stereotyp wird in vielen fiktionalen Geschichten unkritisch übernommen. In meiner Rezension von Peaky Blinders bin ich bereits darauf eingegangen. Dunkelhaarige Frauen gelten meistens als exotisch, „wild“, aber auch intelligent und belesen, wie beispielsweise die Figur Hermine aus den Harry Potter Büchern (1997–2007), die Figur Rory Gilmore aus der Serie „Gilmore Girls“(2000–2007) oder die Figur Belle aus dem Disneyfilm „Die Schöne und das Biest“ (1991) und sind meist die „böse/intelligente“ Gegenspielerin zur „guten/naiven“ Blonden. Dieser Topos wird popkulturell oft als „brainy brunette“ bezeichnet. In „Outlander“ gibt es eine „brünett vs. blond“-Konkurrenz über die erste Staffel hinweg, als ein junges, blondes Mädchen sich für Jamie interessiert, welcher sich allerdings nur für die braunhaarige Claire interessiert, woraufhin sie eifersüchtig auf Claire reagiert und schließlich einen Hexenprozess gegen sie anzettelt. Abgesehen davon spielen Eifersuchts-Konstellationen unter Frauen in der Serie keine Rolle.
Claire ist gebildet, selbstständig und trinkfest. Dadurch fällt sie auf und stößt ab und an auf Widerstände, wird aber oft auch positiv betrachtet. Jamie beispielsweise scheinen ihr Selbstbewusstsein und ihre Eigenständigkeit gut zu gefallen. Ihr medizinisches Wissen und ihre Stärke helfen ihr im 18. Jahrhundert, sich schnell zurechtzufinden und eine einzigartige Position, die der „Heilerin“ einzunehmen. Sie ist gebildeter als die durchschnittliche Frau des 18. Jahrhunderts und kinderlos, was zu dieser Zeit und in ihrem Alter (27 Jahre) außergewöhnlich ist. Ein innerer Konflikt, den diese Figur stets begleitet, ist ihre Zerrissenheit zwischen ihren zwei Leben und ihren zwei Partnern: dem einen in den 1940er Jahren mit ihrem Ehemann Frank Randall, einem Historiker, und dem anderen mit Jamie im Schottland des 18. Jahrhunderts, mit dem sie im Verlauf der Geschichte eine gemeinsame Tochter bekommt. Hier wird das Thema Monogamie/Polygamie angesprochen und zwar in Bezug auf eine Frau, die zwischen zwei Männern steht, von denen der eine (Jamie) deutlich jünger und sexuell unerfahrener als sie ist. Visuell wird diese Dreiecksbeziehung zb in Staffel 1, Folge 11 „Hexenprozess“ gezeigt, als Claire am Finger der linken Hand den glatten, goldenen Ring ihrer Ehe mit Frank trägt und rechts den rauhen, silbernen Ring der Ehe mit Jamie.
Die Figur Claire Randall wird zu Beginn der Geschichte als Frau inszeniert, die nur in der Abwesenheit eines Mannes ihre Stärke und Führungsqualitäten entfalten kann. Sobald ein Mann allerdings die Szene betritt, wird sie zur Seite gedrängt, ganz unabhängig davon, ob sie ihre Aufgabe gut erfüllen konnte oder nicht. Dieser betreffende Mann ist in den Szenen in einer gesellschaftlich höheren Position als sie, da er gebildeter ist. Er ist beispielsweise ein Arzt, wie in der zuvor beschriebenen Szene, ein angehender Professor, wie ihr Ehemann oder ein Archäologe, wie ihr Onkel. Sie selbst hat sich ihre Bildung durch Beobachtung der ihr nahe stehenden Männer angeeignet, aber keinen offiziellen Titel wie sie. Erst bei ihrer Reise in die Vergangenheit und in ihrer Beziehung zu Jamie verkehren sich die Verhältnisse und Claire ist in der dominanteren Position. Nach dem Krieg ist sie ohne Anstellung und führt vorerst ein Leben als Ehefrau. Ihr Ehemann Frank dagegen soll kurz darauf zum Professor berufen werden. Als sie in ein Motel einchecken, um ihre nachgeholten Flitterwochen dort zu verbringen, glänzt Frank mit historischem Wissen über einheimische Rituale (Staffel 1, Folge 1 „Sassenach“, Min 07:11–08:20).
Vermieterin: „Sind Sie Professor, Mr. Randall?“
Frank: „Ich werde es bald sein.“
Claire: „Mein Mann tritt in zwei Wochen einen Posten in Oxford an.“
Vermieterin: „Ah, dann sind dies die letzten freien Tage, bevor Sie wieder ins Arbeitsleben einsteigen, ja? Nun, Sie haben dafür eine gute zeit gewählt. Heute Nacht ist Samhain.“
Claire: „Ich nehme an, das ist gälisch für „Halloween“?
Frank (in ihre Richtung): „Was nur der Vorabend von Allerheiligen ist.“ Claire sieht ihn an und lächelt in sich hinein. Frank schaut die Vermieterin an und erklärt: „Die Kirche hat viele heidnische Feiertage zu ihren Zwecken umbenannt. „Samhain“ wurde zu „Halloween“, „Jul“ wurde zu „Weihnachten“ und so weiter.“ (…)
Vermieterin: „Sie sind beide willkommen bei unseren Festivitäten. Aber denken Sie daran, die Geister sind an den Feiertagen frei. Sie wandern herum und tun Gutes oder Böses, wie es ihnen beliebt.“
Claire: „Natürlich. (sieht Frank an, der nicht zu ihr sieht) Was wäre Halloween oder „Samhain“ wohl ohne eine gute Geistergeschichte?“ (sie grinst)
Das Thema Sex und Fürsorge, welches als Leitmotiv der Serie verstanden werden kann, spielt auch zwischen Frank und Claire eine Rolle. Hier allerdings nur auf einer geistigen Ebene: sie sprechen darüber, weil Frank eifersüchtig auf die Männer ist, die Claire während ihres Kriegsdienstes versorgt hat, denn ihm fällt auf, wie positiv sie von ihren Erfahrungen spricht. Frank selbst muss nie von Claire versorgt werden, bringt sie damit also auch nicht in diese typische Frauenrolle der Sorge-Arbeiterin. Ihre Beziehung ist von intellektueller, ausgewogener Natur. In Folge 1 der 1. Staffel hatte Frank gesehen, wie ein unbekannter Mann vor Claires Haus stand und sie dabei beobachtete, wie sie ihre Haare bürstete. Claire schimpft über die widerspenstigen Haare, aus der Perspektive des Mannes ist die Szene erotisch. Frank fragt Claire, ob der Mann evtl. ein früherer Patient von ihr war. Später in der Serie stellt sich heraus, dass es sich bei ihm um Jamie handelt, der ja tatsächlich ein Ex-Patient und Liebhaber von Claire war, bzw. in der Zukunft noch werden würde.
Frank: Als ich den Kerl gesehen habe, der zu dir herauf gestarrt hat, dachte ich, er war vielleicht ein Patient von dir. Auf der Suche nach dir, um eure Verbindung…aufzufrischen.
Claire: Aufzufrischen?
Frank: Es wäre nicht ungewöhnlich. Nicht überraschend. Du warst auf der Suche nach…Geborgenheit.
Claire: Fragst du mich, ob ich dir untreu gewesen bin?
Frank: Claire…
Claire: Dass du so etwas von mir denkst, Frank! (steht auf)
Durch ihre Care-Arbeit erarbeitet Claire sich im 18. Jahrhundert Privilegien. Colum McKenzie, der Führer des McKenzie-Clans, auf dessen Burg Leoch Claire zu Beginn der Serie lebt, leidet zb an einer Krankheit, die seine Beine verformt und ihm große Schmerzen und Schwierigkeiten beim Laufen bereitet. Claire schlägt alternative Behandlungsmethoden vor, die anschlagen und Colum sehr erleichtern. Daraufhin lädt er sie als seinen besonderen Gast zu einem Fest ein (Folge 3 „Der Weg zurück“, Min 14:03–16:28).
Zusammenfassend kann man sagen, dass Claire Randall aus „Outlander“ eine intelligente, eigenwillige Frau mit großem medizinischem Wissen ist, die zu Beginn der Serie oft im Schatten ihres Ehemanns Frank steht. Durch ihre Zeitreise ins 18. Jahrhundert kann sie ihre Stärke und Unabhängigkeit erstmals vollständig entfalten, wird zur Heilerin, Retterin und Mitgestalterin historischer Ereignisse. Sie ist mutig, leidenschaftlich und folgt kompromisslos ihrem moralischen Kompass, auch wenn das oft gefährlich ist. Claire vereint moderne Denkweisen mit Fürsorglichkeit und wird dadurch zu einer komplexen Figur: Sie ist sowohl eine starke Frauenfigur als auch eine traditionelle Care-Arbeiterin. Ihre Fürsorglichkeit ist ihr Kern, doch gerade diese sorgt in Kombination mit Stärke und Wissen dafür, dass sie manchmal auch zur erotischen Projektionsfläche wird. Trotzdem bleibt sie viel mehr als ein Lustobjekt: eine komplexe, starke Frauenfigur.
When Claire first met Jamie
Während Claire in der Beziehung zu Frank, unabhängig davon, ob er ein liebevoller und interessierter Ehemann ist, immer einen Schritt hinter ihm steht, nimmt sie in der Beziehung zu Jamie von Anfang an eine dominante Rolle ein. Diese ergibt sich aus den Umständen: von Frank stets in Bildungsfragen übertrumpft, kann sie bei Jamie mit praktischem Wissen und direktem Handeln punkten. Da sie aus der Zukunft stammt, ist sie ihm natürlich mit ihrem Wissen überlegen. Sie ist außerdem ein paar Jahre älter als er und sexuell erfahrener12.
In der Szene ihres Aufeinandertreffens ist Jamie verletzt. Er hat sich während eines Kampfes mit englischen Soldaten die Schulter ausgerenkt und kann so nicht weiter reiten. Die Gruppe Männer, mit denen er unterwegs ist, verfügt über rudimentäre medizinische Kenntnisse. Als einer von ihnen ansetzt, Jamies Schulter einzurenken, interveniert Claire, die als Lazarettschwester über fundierteres Wissen verfügt. Führe er fort, würde er Jamies Arm brechen. Sie dagegen weiß, wie man es richtig macht. Beeindruckt von ihrem selbstbewussten Auftreten erlaubt der Anführer der Männer ihr, zu übernehmen und vor aller Augen renkt sie Jamies Schulter auf korrekte Art wieder ein. Er ist erleichtert, als der Schmerz fast sofort nachlässt und Claire gewinnt durch ihr Handeln an Status und Anerkennung.
Claire ist in dieser Szene die einzige weibliche Figur. Sie ist schlank und zierlich im Vergleich zu den muskulösen und zumeist bärtigen Männern. Diese sind noch dazu sehr dreckig. Claire trägt ein unifarben weißes Kleid, welches inzwischen auch nicht mehr ganz sauber ist (sie war zuvor mitten in den Kampf zwischen dieser Gruppe Männer und englischen Soldaten geraten), es ist allerdings weniger dreckig als Kleidung und Körper der Männer, die dunkel gekleidet sind. Man könnte sie als eine Art „Lichtgestalt“ interpretieren. Das Kleid ist am Ausschnitt aufgerissen, sodass der Ausschnitt tiefer ist, und endet kurz unter den Knien. Es ist dadurch freizügiger als die Kleidung der Frauen des 18. Jahrhunderts. Ihre Haare sind offen, dunkel und lockig. Sie sieht „wild“ und ungezähmt aus. Jamie sitzt mit dem Gesicht zum Feuer. Durch den Schein der Flammen werden die Konturen seines Körpers betont und sein rotes Haar leuchtet in einem warmen Ton. Das kalte Licht, welches durch ein Fenster auf seinen Rücken fällt, betont sein breites Kreuz und seinen sehr muskulösen Oberkörper. Sein Hemd ist zur Hälfte heruntergezogen, sodass seine ausgerenkte Schulter deutlich zu erkennen ist. Er sitzt mit dem Rücken zu Claire, die Arme und den Oberkörper geschlungen, den Kopf gesenkt. Sie steht und blickt aus einer Vogelperspektive auf ihn herab. Während sie seine Schulter einrenkt, steht sie ihm gegenüber. Er sitzt und sieht zu ihr hinauf. Die Kamera zeigt eine Normalsicht, Jamie und Claire wirken auf Augenhöhe, obwohl er sitzt und sie steht. Der Bildausschnitt allerdings zeigt Jamie als ganzen Charakter, da man sein Gesicht und Teile seines Körpers sieht, und Claire als Objekt, da ihr Gesicht abgeschnitten ist und man sie nur als Körper von der Brust bis zu den Knien sieht. Dies ist typisch für den male gaze13. In Nahaufnahmen von Claires Gesicht sieht die Kamera aus einer Aufsicht (high-angle) auf sie, auch hier kommt der male gaze zum Tragen, und folgt damit nicht Jamies Blick, denn dann müsste es ja eine Untersicht (low-angle) sein, die Claire extrem mächtig aussehen ließe. Die Vogelperspektive macht die Hierarchie klar: das Publikum blickt von einer leicht erhöhten Position auf Claire drauf. Die Kamera bricht mit der Blickführung, allerdings so minimal und kurz, dass es nur in der genauen Analyse der einzelnen Frames auffällt. Er wird auch aus einer Vogelperspektive aufgenommen, welche wiederum ihrem Blick entsprechen könnte. Auch die extrem sexualisierte Darstellung von Jamies halbnacktem Oberkörper könnte Claires Blick auf ihn zeigen, eine Art female gaze14.
Die Szene ihres Aufeinandertreffens steht als Metapher für die ganze Beziehung zwischen Jamie und Claire. Ihre Rollen sind klar definiert: er zieht in diverse Kämpfe und wird wiederholte Male verletzt und gefoltert, sie kümmert sich anschließend um ihn. Die Körper beider Figuren sind normschön und folgen gängigen, westlichen Schönheitsidealen. Sowohl Jamie als auch Claire werden wiederholte Male halbnackt oder ganz nackt gezeigt. Allerdings wird Jamies nackter Oberkörper immer im Kontext von Kampf und anschließender Verletzung und Versorgung durch Claire gezeigt. Claires Nacktheit dagegen wird im häuslichen Kontext gezeigt, etwa beim Umziehen oder Baden. In den meisten Pflege-Szenen zwischen Claire und Jamie ist sein Oberkörper nackt und sexualisiert dargestellt, während Claire bekleidet ist. Sie trägt zwar häufig Kleider mit einem tiefen Dekolleté, allerdings bedeckt sie dieses auch oft mit einem Tuch oder Schal. Jamies Verletzungen befinden sich fast immer an seinem Oberkörper, sodass er seine Oberbekleidung für die Pflege-Szenen zwischen ihm und Claire ablegen muss. Die Kamera gleitet langsam über seinen muskulösen und schlanken Torso. Claires vorsichtige Berührungen und sein leichtes Stöhnen verstärken die sexuelle Spannung und deuten optisch und visuell auf eine mögliche, folgende Sexszene hin und selbst wenn diese nicht folgt, wird hier definitiv die (sexuelle) Fantasie des Publikums angeregt. Eine Verletzung am Hinterteil oder am Fuß wäre weniger erotisch und würde vom Publikum eventuell sogar als komisch oder lächerlich empfunden. Jamies Verletzungen dienen immer einem erotischen Zweck und sind nie so gewählt, dass sie ihn entstellen oder entblößen. Er ist an keiner Stelle „hässlich“ verletzt oder hat eine abstoßende Wunde. Die Pflege-Szenen zwischen Jamie und Claire sind bewusst erotisch inszeniert und romantisch-verklärt. Ein realistische Darstellung einer Kriegsverletzung wäre bar jeder Erotik und Romantik, würde aber auch die Aussage der Geschichte grundlegend verändern. Die Darstellung von Jamie bedient unterschiedliche Bedürfnisse: sein Körper wird als visueller Anreiz extrem sexualisiert dargestellt und soll ein weibliches, heterosexuelles Publikum ansprechen. Gleichzeit folge er typisch männlichen Heldenmustern, sodass auch ein männliches Publikum sich mit dieser Figur identifizieren kann.
Aus Fürsorge wird Liebe
Pflege, körperliche Nähe und körperliche Anziehung sind ein dauerhaftes Thema zwischen Claire und Jamie und das Leitmotiv der Geschichte. Die Pflegeszenen zwischen Claire und Jamie sind oft die Grundlage für Gespräche und Diskussionen. In einem sicheren Rahmen eingebettet entsteht Intimität und Vertrauen und beide Figuren öffnen sich einander.
„Gefühlsarbeit ist in der Regel eingebunden in andere Tätigkeiten, in Arbeiten, in denen Gefühle zum Ausdruck kommen können wie, z.B. das Kochen – oder in solchen, die neben ihrer Verrichtung die Beschäftigung mit anderen Menschen ermöglichen, wie z.B. das Bügeln. Sie setzt spezifische Fähigkeiten – wie z.B. Intuition und Empathie – als notwendig voraus, um zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen und erhalten zu können. Der Begriff Gefühlsarbeit entstand in den Diskussionen der neuen Frauenbewegung und wird oft an Stelle des Begriffs Beziehungsarbeit gebraucht“.15
Im Verlaufe der ersten Staffel werden Jamie und Claire ein Paar. Als Jamie entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und schwer verletzt wird, beteiligt sich Claire an seiner Rettung. Sie richtet seine gebrochenen Finger und sorgt dafür, dass er seine Hand weiter nutzen kann, indem sie sie operiert. Sie hilft ihm mit praktischem Handeln und medizinischem Wissen. Als Claire wiederum entführt und ihr der Prozess als Hexe gemacht wird, rettet Jamie sie und bringt sie in seine sichere Heimat. Obwohl beide viel durchmachen, wird Claire als psychisch sehr stabil gezeigt, während Jamies Figur sowohl physische als auch psychische Auswirkungen erkennen lässt. In den meisten Erzählungen ist es andersherum, wirkt die Frau fragil und zerbrechlich, während der Mann trotz Gewalterfahrung stets stark und rational auftritt (in besagtem Text zu Peaky Blinders wird zb auch das erwähnt).
Gemeinsam überstehen sie Jamies diverse Traumata und begeben sich auf eine Reise nach Frankreich. Dieses Erlebnis festigt ihre Beziehung. Jamie vertraut Claire, da sie ihn in seinen dunkelsten und verletzlichsten Momenten nicht fallen gelassen hat. Im Verlauf der Geschichte durchleben sie jede Menge Krisen und eine Zeit der Trennung, während dieser Claire das gemeinsame Kind zur Welt bringt, welches sie mit ihrem anderen Ehemann Frank in den 1950er Jahren großzieht. Trotz der sehr langen Trennung bleibt ihre Liebe und ihre körperliche Anziehung bestehen. Das Leitmotiv von Fürsorge und Liebe zieht sich als roter Faden durch die gesamte Geschichte und bleibt bis zum Ende bestehen.
Fazit
Der Florence-Nightingale-Effekt zeigt Frauen, die nur stark sind, wenn ein Mann schwach ist. Sie verbleibt in einer Abhängigkeitsrolle. Es ist möglich, auch innerhalb dieses Erzählmusters eine kritische Haltung einzunehmen, wenn beispielsweise diese Abhängigkeit thematisiert wird, die Frauenfigur mit ihrer Rolle hadert oder sie evtl. sogar ablehnt. „Outlander“ deutet eine solche Haltung mit der Figur Claire an, bleibt aber sehr zurückhaltend. Der Florence-Nightingale-Effekt kann als konservativ bezeichnet werden, weil er Geschlechterkodierungen nicht kritisch hinterfragt. Frauen sind „immer“ fürsorglich und werden als emotional und empathisch dargestellt. Es gibt keine Szene, in der dieses Verhältnis aufgebrochen wird, weil eine Frau beispielsweise keine Lust hat, sich um den kranken/verletzten Mann zu kümmern, weil sie nicht empathisch ist oder weil ein Mann diese Rolle übernimmt. Männer treten hier lediglich als Arzt in Erscheinung, also in einer hohen Position, und sind stets sachlich und rational. Die Sorge-Arbeit verbleibt bei den Frauenfiguren. In aktuellen Serien könnte dieses Erzählmuster durchbrochen werden, indem bspw. die Rollen verkehrt würden, sodass eine männliche Figur sich um eine verletzte weibliche Figur kümmert. Sollte eine solche Geschichte in einem Kriegskontext erzählt werden, gibt es spätestens seit den 1990er Jahren diverse Geschichten, in denen weibliche Soldatinnen vorkommen, wie „G.I. Jane“ (1997) oder in der Science-Fiction-Serie „The Expanse“ (2015–2022). Man könnte auch zwei Figuren mit dem gleichen Geschlecht in eine solche Situation versetzen, um dann zu überlegen, wie sie handeln würden. Würden zwei Männer als homosexuell interpretiert werden? Würde jegliche sexuelle Andeutung wegfallen, wenn eine Frau sich um eine andere Frau kümmert? Eine gleichgeschlechtliche Konstellation würde Geschlechterhierarchien aufbrechen und Fragen von Abhängigkeiten und körperlicher Über- und Unterlegenheit ganz anders bewerten. Die Pflegerin im Florence-Nightingale-Schema wird oft als empathisch, fürsorglich und belastbar dargestellt. Diese Eigenschaften sind durchaus Ausdruck von innerer Stärke. In vielen Filmen oder Serien ist sie die emotional stabile Figur im Gegensatz zum (verletzten, geschwächten) Mann. In fast allen Darstellungen bleibt die Figur der Pflegerin aber in der fürsorglichen Rolle „gefangen“ und ihre Bedeutung entsteht fast ausschließlich in Beziehung zu einem Mann, nicht aus Eigeninteressen oder Selbstverwirklichung. Damit ist sie kein unabhängiger Charakter, sondern Trägerin eines alten, patriarchal geprägten Rollenmodells – die Frau als Dienerin des Mannes.
Quellenangaben
- Cambridge Dictionary definiert „outlander“ als „a person who is not from your country or area“. URL: https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/outlander#google_vignette. Abgerufen am 13.5.2025 ↩︎
- „Starz completes its separation from Lionsgate and begins trading today under ticker symbol STRZ on Nasdaq,“ StockTitan, 7. Mai 2025, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2025, URL: https://www.stocktitan.net/news/STRZ/starz-completes-separation-from-lionsgate-and-begins-trading-today-r8kmxrrlbzpu.html. ↩︎
- “Aeneis,” Wikipedia, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Aeneis, abgerufen am 3. Juli 2025 ↩︎
- Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, Buch I, Kapitel 41 (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1857), Seite 218–220 ↩︎
- Beispielswiese in dem Film „Garp und wie er die Welt sah“ (1982). Die Figur Jenny Fields erkennt ihre Chance auf ein Kind ohne einen Mann, als sie während des Zweiten Weltkrieges in einem Lazarett arbeitet und auf einen Soldaten trifft, von dem sie weiß, dass er bald sterben wird. Sie zeugt daraufhin ein Kind mit ihm und zieht es nach seinem Tod ein paar Tage später wie geplant alleine groß. „He was dying, I wanted a child. Seemed like a good way to have one without the bother of a husband hanging around who had legal rights to my body, so…“ ↩︎
- In dem Film „Abbitte“ (2007) verwechselt ein tödlich verwundeter Soldat die Lazarettschwester Briony mit einer früheren Geliebten. Weil sie weiß, dass er die nächsten Stunden nicht überleben wird, spielt sie mit und schenkt ihm diese „letzte Begegnung“. ↩︎
- Encyclopaedia Britannica. (o. J.). Hospital. URL: https://www.britannica.com/topic/hospital, abgerufen am 7.7.2025 ↩︎
- U.a. von Simone de Beauvoir mit ihrem berühmten Zitat „Man wird nicht als Frau geboren; man wird es.“ aus ihrem Buch „Das andere Geschlecht“ (1949) ↩︎
- Nancy Fraser, „Contradictions of Capital and Care,“ New Left Review 100 (Juli/August 2016), o.S. (Online-Ausgabe), URL: https://newleftreview.org/issues/ii100/articles/nancy-fraser-contradictions-of-capital-and-care.com, abgerufen am 27.6.2025 ↩︎
- Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO). WIdOmonitor 2024: Pflegende Angehörige wenden im Schnitt 49 Stunden pro Woche für häusliche Pflege auf. Repräsentative Forsa-Umfrage, August/September 2023. URL: https://www.aok.de/pp/bv/pm/widomonitor-zu-pflegenden-angehoerigen/, abgerufen am 2.7.2025 ↩︎
- S. Weir and M. Fine-Davis, “Dumb Blonde and Temperamental Redhead: The Effect of Hair Colour on Some Attributed Personality Characteristics of Women,” Irish Journal of Psychology 10, no. 1 (1989): 11–19, https://doi.org/10.1080/03033910.1989.10557730. ↩︎
- Staffel 1, Folge 6 „Black Jack“. Als Claire und Jamie heiraten sollen, offenbaren sie sich einander: sie ist keine Jungfrau mehr, er dagegen schon. ↩︎
- Laura Mulvey prägte 1975 in ihrem Essay „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ den Begriff male gaze, welcher den männlichen Blick auf weibliche Charaktere zeigt. Sie kritisierte u.a. das Frauenkörper oft grundlos sexualisiert gezeigt werden. ↩︎
- Ein Pendant zum male gaze ist der female gaze, also der weibliche Blick. Hauptsächlich geht es in Filmen, die sich des female gaze bedienen, um komplexe Frauenfiguren aus der Sicht von Frauen. Oberflächlich eingesetzt dreht er die Verhältnisse einfach nur um und macht statt der weiblichen die männliche Figur zum Objekt. ↩︎
- Elke Schimpf, „(Für-)Sorgearbeit – Hausarbeit – Care-Arbeit: Soziale Arbeit – eine vergeschlechtlichte Profession,“ in Gender und Soziale Arbeit. Ein Handbuch für Studium und Praxis, hrsg. von Regina Frey, Ilse Lenz und Sabine Stövesand, 2. Aufl. (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 58, unter Verweis auf Gabriele Riemann, „Gefühlsarbeit. Über die soziale Herstellung von Gefühlen,“ Widersprüche Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 15 (1985): 14f.. ↩︎